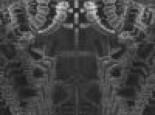Von Sebastian Müller
Er ist ein Populist, ein Aufwiegler, ein herrschafts- und rachsüchtiger Machtmensch. Er verspricht das blaue vom Himmel und seine Ideen entspringen einem Wolkenkuckucksheim. Nicht zuletzt ist er nationalistisch. Dieser Tenor schallt quer durch die Republik, von Nord nach Süd, von West nach Ost, von „Bild“ zur „Welt“, von „Spiegel“ zu „Stern“. Jeder “informierte” Bundesbürger weiß mittlerweile, dass Oskar Lafontaine ein Demagoge und Volksverhetzer ist.
Dieses Bild des ehemaligen Kanzlerkandidaten wird die Erinnerung vieler Menschen prägen, und viele haben ein Interesse daran, das Lafontaine auf diese Weise einen unrühmlichen Platz in den Geschichtsbüchern erhält. Nicht er, der einer zu schnellen deutschen Wiedervereinigung skeptisch gegenüberstand [1], wird wohl in positiver Erinnerung bleiben, sondern der „Einheitskanzler“ Helmut Kohl. Lafontaine dagegen ist ein Fahnenflüchtiger, der sich aus seiner Verantwortung als Bundesfinanzminister in der rot-grünen Koalition davongestohlen hatte – 1999 war das. Aus egoistischen, machtsüchtigen Perspektiven habe er damit den Niedergang der altehrwürdigen SPD eingeleitet, für deren Krise er nun allein verantwortlich sei. So schallt es aus der Parteizentrale der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die längst nicht mehr sozialdemokratisch ist.
Hier könnte man von einer Zäsur sprechen, von einem Scheidepunkt, an dem diese Geschichte Lafontaines vielleicht erst wirklich begann – und spätestens hier ist man verpflichtet, den medialen Tiraden und Deutungsversuchen ein anderes Bild Lafontaines entgegenzuhalten, ohne ihn von jedem Tadel frei sprechen zu wollen.
Als allererstes zeigt sein Rücktritt aus allen Ämtern der SPD am jenen März 1999, dass Lafontaine entgegen den meisten Karrieristen – die heute in der politischen Klasse anzutreffen sind – eben kein Opportunist war und ist. Er hat ein politisches Profil und eine politische Überzeugung, die das rhetorische Talent vielleicht von allen Polit-Agiteuren um ihn herum am überzeugendsten vertreten konnte. Diese, seine Überzeugungen – so die Notwendigkeit der Regulierung der Finanzmärkte sowie das Eintreten für eine keynesianische Fiskal- und Geldpolitk – waren im Finanzministerium unter einem Gerhard Schröder nicht mehr umzusetzen [2]. Ganz unverblümt teilte ihm Schröder damals mit, dass eine Politik gegen die Konzerne und die Finanzindustrie mit ihm nicht zu machen sei!
Lafontaine muss man zugute halten, dass er für eine vernunftgeprägte Wirtschafts- und Finanzpolitik gerade stand, die eben nicht dem neoliberalen Zeitgeist entsprach, der damals bis heute der politischen Klasse den Kopf verdreht. In diesem Kontext war er auch einer der ersten, die vor einer drohenden Finanzkrise warnten. Damals wurde er noch belächelt.
Lafontaine war bereit, für seine politische Linie die Konsequenzen zu ziehen. Mehr noch, selbst seine Gegner mussten anerkennen, dass er ein Stratege und Visionär war (wenn von diesen auch meist negativ determiniert), wie er mit der brillianten Antwort auf die neoliberale Korrumpierung des deutschen Parteiensystems bewies – der Gründung einer gesamtdeutschen Partei links von der SPD. Bis heute hat er seine Vision einer sozialdemokratischen Republik entgegen aller Widerstände im großen Teils reaktionär-konservativen Deutschland aufrechterhalten und dieser Konturen gegeben. Er hat die sozialdemokratischen Prinzipien, die unter Schröders SPD und ihrem Transformationsprozess zur “Neuen Mitte” aufgegeben wurden, in der Linkspartei weitergeführt, bzw. in Die Linke hinübergerettet. Er hat der deutschen, linken Bewegung ein Gesicht, eine parlamentarische Vertretung und dort zuletzt einen Programmentwurf gegeben.
Eine politische Linie und eine Überzeugung, geschweige denn eine Vision sind genau die entscheidenden Bedingungen, die die Politik heute, im dogmatischen Festhalten am ökonomischen Paradigma und bloßem Verwalten der neoliberalen Ideologie verloren hat. Der Widerstreit unterschiedlicher Konzepte machen das Politische aber erst aus. Aus dieser Perspektive ist die Entpolitisierung unserer Gesellschaft und die Krise der Demokratie zu deuten. Lafontaines unwiderruflicher Verdienst ist sein Versuch, der Politik diesen Diskurs, den Streit um wirkliche politische Inhalte und Alternativen, zurückzugeben. Das, und sein Vermögen, wie sonst niemand den Finger in aller Klarheit auf die Wunden unserer Gesellschaft zu legen, macht ihn integer. Welche Spitzenpolitiker können das sonst noch heute von sich behaupten?
Sein gesundheitsbedingter Rückzug aus der Bundespolitik wird ein herber Verlust sein – nicht nur für Die Linke, sondern auch für unsere politische Kultur.
[1] Lafontaine glaubte wie viele führende SPD-Politiker, eine „Wieder“-Vereinigung setze die falschen politischen Prioritäten und wecke erneut Ängste vor deutscher Überlegenheit im europäischen Ausland. Er sah die Idee des Nationalstaats für die Zukunftsgestaltung im Zeitalter der europäischen Integration als unzeitgemäß an. Er betonte dagegen die Tradition des sozialdemokratischen Internationalismus und strebte eine nationale Einheit als Ergebnis, nicht Voraussetzung annähernd gleicher Lebensverhältnisse und Entfaltungschancen an. So stimmte er mit vielen ostdeutschen Bürgerrechtlern darin überein, dass die DDR sich ohne westlichen Druck zuerst selbst politisch und vor allem wirtschaftlich reformieren solle. Er wollte ihre Eigenstaatlichkeit also zunächst erhalten. Dazu befürwortete er eine Konföderation beider deutscher Teilstaaten im Rahmen eines gesamteuropäischen Vereinigungsprozesses.
Wegen seiner öffentlichen Bedenken gegen Kohls Plan wurde Lafontaine von politischen Gegnern vorgeworfen, er habe die deutsche Einheit innerlich nicht gewollt, daher verhindern wollen und kein eigenes Konzept für den Einigungsprozess gehabt. Er selbst betonte dagegen, er habe die staatliche Wiedervereinigung an sich nicht abgelehnt, sondern nur die soziale Angleichung der Lebensverhältnisse vorhergehen lassen wollen.
[2] Im Oktober 1998 wurde der Ökonom Heiner Flassbeck zum Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen berufen und beriet Oskar Lafontaine bei dessen Vorhaben, gemeinsam mit dem französischen Finanzminister Dominique Strauss-Kahn eine keynesianische Finanz- und Währungspolitik auf europäischer Ebene zu etablieren. Nach dem Ausscheiden Oskar Lafontaines im März 1999 als Bundesfinanzminister endete im April 1999 auch Flassbecks Tätigkeit als Staatssekretär.